
Ihr Lieben, aus gegebenem Anlass hoffe auch ich natürlich, dass es Euch und Euren Liebsten gut geht. Das Coronavirus zieht sich jetzt schon seit einigen Wochen durch alle Bildschirme, Instagramfeeds und Media Live Ticker der Welt – wir haben Benachrichtigungen abgeschaltet, weil wir sie nicht mehr ertragen konnten und sie dann doch wieder eingeschaltet, weil der Drang nach Aktualität uns übermannt hat. Täglich ändern sich Wissensstand und Regelungen zur Pandemie und auch ich bin der Meinung, dass wir die Informationen nutzen sollten, um unser Verhalten reflektieren zu können. Seit drei Wochen ist es nun offiziell: Keine Ausgangssperre, aber Kontaktverbot. Bedeutet: Kein Kaffee mehr in der Sonne mit der wöchentlichen Pilatesgruppe und kein feierliches Frühlingskommittee beim Picknicken mitten auf dem Tempelhofer Feld. Was sich für viele erstmal wie ein massiver Eingriff in den Alltag angefühlt hat, ist für mich, um ganz ehrlich zu sein, schon seit mehreren Wochen zuvor Standardprogramm gewesen. Ich habe aufgehört zu zählen, aber irgendwo zwischen Tag 33 und und Tag 36 befinde ich mich, alleine, in meiner 38 qm Wohnung, in “Selbst-Quarantäne”. Während die meisten in meinem Umfeld mit ihren Familien oder Partner*innen zusammen im Homeoffice hocken oder mit den Mitbewohner*innen Homeworkout-Dates ausmachen, gestalteten sich meine letzten Tage orientiert an einzig und allein: Mir. In dieser Zeit hat sich eine seltsame Mischung aus Nostalgie und Optimismus in meinen Alltag geschlichen, die das Konzept von Me-Time nochmal von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Ein paar meiner Gedanken möchte ich mit Euch teilen.
Vorab möchte ich eines festhalten: Wir sollten uns bewusst sein, dass unabhängig davon, in welcher Konstellation wir uns momentan durch diese Krise schlagen, wir uns sehr wohl in einer privilegierten Position befinden und nicht vergessen sollten, dass weiterhin Menschen unter unmenschlichen Umständen zu überleben versuchen – mit oder ohne Virus. Ein Dach über dem Kopf und genug Essen auf dem Tisch zu haben, machen das “Meckern” nämlich um einiges einfacher. Wenn wir möchten, können wir sogar Klopapier hinterherjagen. Trotzdem macht diese Umstellung etwas mit uns. Sie lässt unser Miteinander überdenken, wie wir mit anderen, aber auch mit uns selbst umgehen. Abgesehen von den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Aspekten sind es eben auch jene zwischenmenschliche, die uns in dieser Zeit vor neuen Herausforderungen stellen. Getrennt lebende Paare schnappen sich noch schnell die Zahnbürste und rasen in die Wohnung der Freundin oder des Freundes. Während sich die einen seit Ewigkeiten nach dieser Zweisamkeit gesehnt haben, machen sich andere sorgen, wie sie das Zusammensein ohne anschließender Trennung überstehen sollen. Mit zwei nervösen Kindern am Bein, die Arbeit und das Leben von zuhause aus zu planen, dabei für ausreichend Abwechslung auf dem Herd zu sorgen und trotzdem nicht sich selbst in dem Ganzen zu verlieren, klingt alles andere als romantisch. Aber genau die Romantisierung dieser Isolation auf den sozialen Netzwerken hat mich die letzten Tage ziemlich zum Nachdenken gebracht.

“Jetzt ist die Zeit, um all das anzugehen, was du dir schon immer vornehmen wolltest!”, “Endlich mal den Schrank ausräumen!”, “Einfach mal wieder backen!” und zwischendrin Yoga Sessions mit der Community zelebrieren – stets nach dem Motto #staypositive. Postings, die momentan vermutlich nicht nur mein Feed zieren. Es scheint beinahe so, als würden wir einen Zustand feiern, auf den unsere Gesellschaft geformt von Druck und konstanter Performanz förmlich hingefiebert hat. Sozusagen die Pause daheim, die wir uns alle verdient haben. Versteht mich nicht falsch, es ist nur richtig diese Dinge anzugehen, wenn sie einem gut tun. Und irgendwie versuchen wir uns alle nur in dem Wahnsinn zurecht zu finden. Trotzdem haben diese Beiträge gebündelt einen seltsamen Beigeschmack. So vermitteln sie einem das Gefühl, man müsse das Beste aus der Situation machen, orientiert an Lifestyleelementen, die eben auf zahlreichen Plattformen propagiert werden. Fleißig sein, fröhlich sein, schick sein – außerdem mit Witz und Humor fit bleiben, damit wir, nachdem wir diese Krise überwunden haben, genauso weitermachen können wie zuvor. Zudem das Zuhausebleiben nicht automatisch für jede*n ein safe space ist, wie es auf Social Media gerne Mal einseitig dargestellt wird. Wer zum Beispiel unter psychischen Erkrankungen oder unter häuslicher Gewalt leidet, sieht sich mit dieser Maßnahme ganz anderen Problemen konfrontiert. Was mich also besonders stört? Die in der Öffentlichkeit zwanghaft dargestellten fehlerfreien Lifestyles und das Fehlen von dem gegenüber verglichenen scheinbar “gescheiterten” Herangehensweisen. Dass Instagram und Co. schon lange als Leinwand für optimierte Lebensweisen herhalten, ist zwar nichts Neues, vor allem in der aktuellen Situation habe ich mir irgendwie Anderes erhofft. Im Nachhinein ein ziemlich naiv-optimistischer Anspruch von mir, ich weiß.

Mich hat dieses ganze “wie ich zu sein habe” die letzten Wochen ziemlich überfordert. Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber ich habe meinen Schrank genau einmal aufgemacht: Und zwar um meine Jogger rauszukramen. In meinem Hausflur riecht es jeden Tag wunderbar nach frisch gebackenem Kuchen, meine Backform blieb auch in Coronazeiten bisher unberührt in der Originalverpackung in irgendeinem Schrank. Den Spiegel, den ich schon immer mal lackieren wollte, habe ich zumindest mit Glasreiniger poliert bekommen. Habe ich deswegen ein schlechtes Gewissen? Ja, schon. Zumindest die ersten Tage meiner selbst ernannten Quarantäne. Wenn einem den ganzen Tag vorgehalten wird, was in 24 Stunden theoretisch alles so möglich ist, wirkt mein Alltag ziemlich bescheiden. Dabei habe ich bestimmt länger als eine Woche gebraucht, um die gesamte Situation erstmal mental zu verarbeiten und mich überhaupt orientieren zu können. Mit diesem Prozess habe ich mich zu Beginn der Isolation ein wenig allein gelassen gefühlt und das lag nicht daran, dass ich alleine lebe. Vielmehr hat mir die virtuelle Welt das Gefühl vermittelt, dass ich fiktiven Ansprüchen nicht gerecht werde. Als Lösung mussten zwar nicht die Newsticker, dafür aber die sozialen Netzwerke für ein paar Tage ruhen.
Die Social-Media-Abstinenz hat gut getan. Anstatt mich täglich mit To-Do-Listen anderer Menschen zu vergleichen, habe ich mich an meine eigenen Tagesabläufe gewöhnt. Mittlerweile habe ich sogar einen zufriedenstellenden Rhythmus gefunden. Da sich der Handlungsspielraum eben minimalistischer gestaltet, musste ich nach einer neuen Struktur suchen, um nicht ganz das Zeitgefühl zu verlieren. Bevor ich also die Frage beantworten konnte, womit ich am besten in den Tag starte, habe ich erstmal klären wollen, wofür ich überhaupt in den Tag starte. Sprich: Ziele setzen, sowohl kurzfristige als auch langfristige. Mal ganz unabhängig von irgendwelchen extern definierten Idealvorstellungen. Hierbei sollte es um Wünsche gehen und nicht um Zwänge. Ich habe gemerkt, dass ich um einiges entspannter einen Tag abschließen kann, wenn ich meine Erwartungen runterschraube. Wenn der Einkauf von Lebensmitteln nun mal an dem Tag an oberster Stelle steht, dann ist das für diesen Tag ein wichtiges kurzfristiges Ziel, das angegangen werden kann. Das ist ausreichend und völlig ok, auch, wenn man das erstmal zu akzeptieren lernen muss. Und wenn man den ganzen Tag nicht einmal den Müll rausgetragen bekommt, darf man die fehlende Motivation trotzdem mit Eis und Film belohnen. Es ist toll, wenn die Woche voller Ambitionen und Tatendrang beginnt. Es ist aber auch völlig legitim traurig zu sein, weil man seine besten Freund*innen seit mehreren Wochen nicht mehr gesehen hat. Oder einen ganzen Tag lang zu jammern, bis man sich selbst nicht mehr hören kann. Solche Emotionen sollten genauso ihren Platz haben dürfen wie all die Adrenalinkicks nach Pamela Reifs Homeworkoutsessions.
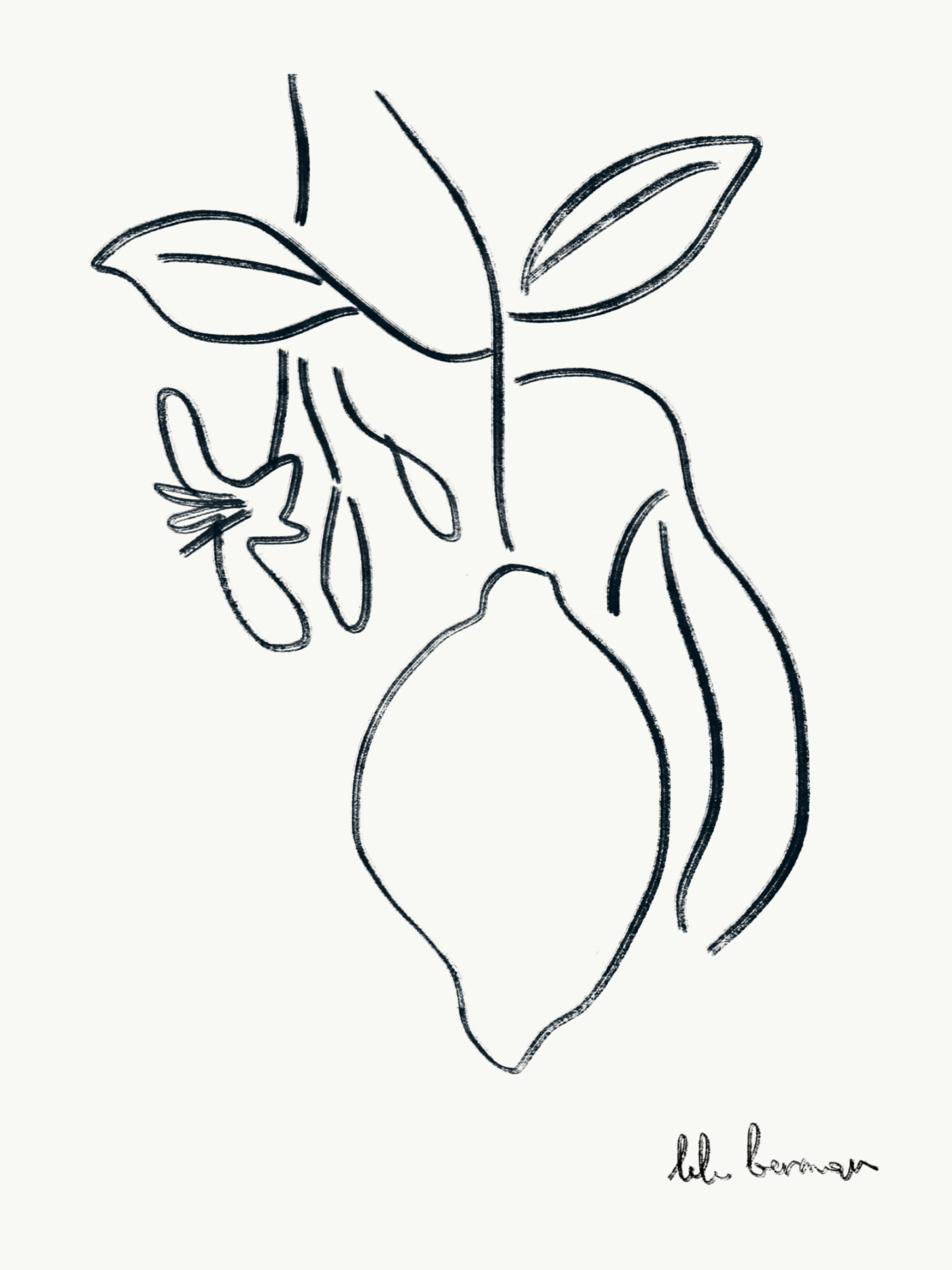
Gleiches gilt für die langfristigen Ziele, die sich nur müßig definieren lassen. Wenn man gezwungenermaßen in seiner Blase lebt, ist es gar nicht so einfach, auf Fragen wie “Was willste denn nun eigentlich für dich?” zu antworten. Trotzdem halte ich diese Ziele für wichtig. Sie können uns Weitsicht und die Möglichkeit geben, die aktuelle Zeit für Dinge zu nutzen, die sich im Nachhinein positiv auf Projekte in der Zukunft auswirken können. Aber auch das sollte keine Vorgabe sein, sondern ein natürlicher Prozess, den man nachgehen kann, wenn man das möchte. Mein Tipp? Ob mit oder ohne Talent – kreativ zu sein und selbst den Pinsel in die Hand zu nehmen. Aber auch Artikel zu lesen oder Filme zu schauen, die man schon lange in der Pipeline hatte oder von denen man weiß, dass sie einem gut tun. Sich generell mehr mit Material und Menschen zu beschäftigen, die inspirieren und Anreize setzen, mal fernab von all den schlechten Nachrichten, die uns so oder so erreichen. Ich musste in diesem Zusammenhang an ein Interview mit einem schwedischen Möbeldesigner denken. Auf die Frage, wieso Schweden*innen so innovativ sind, antwortete er, dass in Skandinavien die kalten Monate und die damit schnell einbrechende Dunkelheit genutzt werden, um in den eigenen vier Wänden Ideen zu sammeln und sich auszuprobieren, damit in den Sommertagen das Leben und die Visionen draußen präsentiert werden können. Vielleicht sehen wir ja die aktuelle Phase ein klein wenig als unseren persönlichen schwedischen Winter?
Unabhängig von den Dingen, die ich momentan selbst in der Hand habe, will ich ehrlich sein: Obwohl ich normalerweise gerne alleine bin und die Zeit mit mir sehr zu schätzen weiß, bin ich doch früher als erwartet an meine Grenzen gestoßen. Meine Mutter, die ich sonst einmal die Woche besucht habe, habe ich nun seit über einem Monat nicht mehr gesehen. Meine Freund*innen auf dem Display zu sehen, war die erste Zeit noch ganz witzig, nach vielen mehrstündigen Calls fehlte mir der physische Kontakt und die körperliche Nähe schon sehr. Auch das Spazierengehen auf Abstand ist ok, aber einfach nicht das Gleiche. Ich habe gemerkt, wie kitschig und empfindsam ich alleine werde. Wie sehr ich die Umarmung meiner besten Freundin und die tröstende Schulter meiner Mutter vermisse und wie viel weniger wert ich auf die blöde Me-Time lege, die ich sonst über alles gestellt habe. Denn ohne Ablaufdatum dauerhaft nur mit sich zu sein, weil man es sein muss, kann manchmal ganz schön einsam sein. Da hilft auch keine Hundertste Gesichtsmaske. Trotzdem lässt sich aus dieser begleitenden Nostalgie etwas Positives ziehen. Dafür knüpfe ich nochmal an mein kitschiges Gemüt an: Möglicherweise ist es genau das, was wir aus solchen Zeiten mitnehmen – Kleinigkeiten wahrzunehmen und zu schätzen, Gesten lieben zu lernen und Menschen zu vermissen, die zuvor so selbstverständlich in unserem Leben waren. Denn schlussendlich sind es doch eben diese Dinge, auf die wir uns am meisten freuen und die uns auf eine entspanntere Zeit nach einer Krise hoffen lassen.
Passt gut auf Euch auf.
Eure, Yildiz
P.S.: Gerne freue ich mich über Eure Gedanken zu diesem Thema!
Alle Illustrationen in diesem Beitrag sind von Elena Berman und mit Genehmigung hier veröffentlicht.
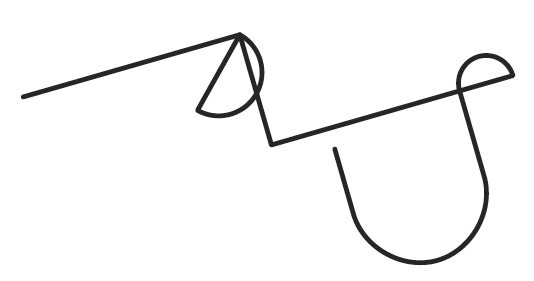

liebe Yildiz, ich bin gerade sehr dankbar, dass unsere Kinder uns die Struktur für die Tage “vorgeben”. Man funktioniert halt und hofft auf einen Tag X. Mich persönlich frustriert vor allem, dass immer noch nicht feststeht, wann das ist. Ohne einen konkreten Ausblick gibt es eben nichts, worauf man “sich freuen kann”. Dieses Hinfiebern auf einen Tag steckt eben doch sehr in uns drin.
Ich versuche gerade einfach dankbar zu sein, für 10 Minuten Yoga am Abend, für viel frische Luft und dafür das ich nicht parallel zur Kinderbetreuung arbeiten muss.
Was du beschreibst, die Auseinandersetzung mich sich selbst und dem was man eigentlich will, halte ich auch für wichtig. Es ist der Fluch und Segen unserer Zeit, dass uns das “Internet” gut beschäftigt, aber eben auch ablenkt von den eigentlich Fragen, die man lieber im Stillen mit sich klären muss. Davor “flieht” man ja fast in dem man lieber weiter im Netz konsumiert. Es ist halt “leichter”. Gewohnheiten stellen sich nicht von heute auf morgen um. Aber wenn man etwas ändern will, muss man damit anfangen. Warum nicht jetzt, wo dieser Einschnitt uns alle betrifft? Es kann ja auch wieder so eine Phase geben, in der wir noch einmal zu Hause bleiben muss und vielleicht tut es mit diesem Ausblick gut etwas zu ändern.
Liebe grüße nach Berlin und alles Gute für dich! Maria